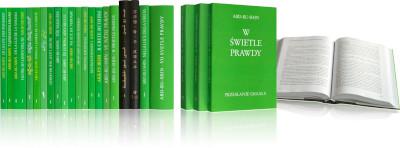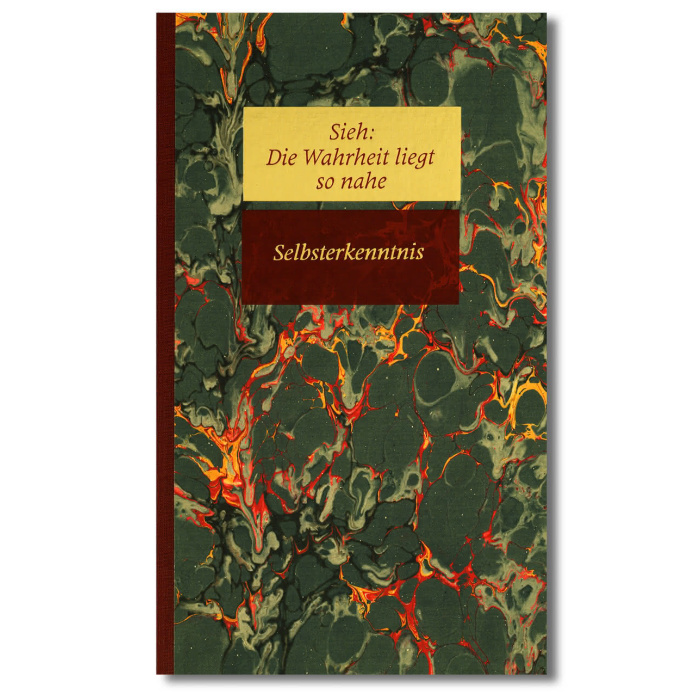Selbsterkenntnis – Werkausgabe, Band 2 (E-Book)
Dr. Richard Steinpach (1917–1992) war ein Meister darin, ganzheitliche Zusammenhänge mit Hilfe einfacher Alltags-Gleichnisse plausibel zu machen. Er hielt in den 1980er Jahren vielbeachtete Vorträge zu zentralen Lebensfragen im gesamten deutschsprachigen Raum und zählte über Jahrzehnte zu den wichtigsten Autoren des „Verlags der Stiftung Gralsbotschaft“. In der Werkausgabe „Sieh: die Wahrheit liegt so nahe“ sind seine wichtigsten schriftstellerischen Arbeiten zusammengefaßt. „Selbsterkenntnis“ ist Band 2 der Werkausgabe und enthält folgende Beiträge:
Wann entsteht ein Mensch?
Was ist das überhaupt – eine Frau?
Die mißverstandene Gleichheit
Wohin führt die Mode?
Der gutgemeinte Irrtum
AIDS – die unterlassene Abwehr
WANN ENTSTEHT DER MENSCH?
Immer noch Ungewißheit
Ist es nicht erschütternd, daß die Antworten auf diese uns alle berührende Frage bis heute noch höchst ungewiß sind? Da sehen die einen schon den Moment der Zeugung, die anderen erst jenen der Geburt als entscheidend an. Der Gesetzgeber schließlich, in dem Bestreben, für die Freigabe des Schwangerschaftsabbruches irgendwo eine Grenze zu finden, hat diese mit drei Monaten festgesetzt. Er hat damit die Groteske geschaffen, daß von einem Tage zum anderen etwas bestraft wird, was zuvor noch erlaubt war, ohne daß man eigentlich wüßte, was sich inzwischen geändert hat.
Doch die Entstehung des menschlichen Lebens vollzieht sich in gleicher Weise – gestern, heute und morgen. Muß den denkenden Menschen da nicht ein Schauder ergreifen ob des Geredes, das über diese Frage entstanden ist? Das unveränderlich in der Schöpfung Festgelegte ist Gegenstand der Tagespolitik geworden, die sich an kurzlebigen Interessen ausrichtet.
Auch die Wissenschaft, die wir zu Rate ziehen, läßt uns im Stich. Sie kann einen bestimmten Zeitpunkt nicht nennen, ab welchem das Werdende als Mensch zu bezeichnen wäre. Denn es handelt sich um eine beständige Fortentwicklung, die mit der Befruchtung beginnt und im Geburtsvorgang endet. Die Unterteilung, die vorzunehmen von der Wissenschaft verlangt worden ist, blieb unbestimmt, schwankend, mehr oder weniger willkürlich.
Das Gesetz, um dessen Inhalt die Auseinandersetzungen entbrannt sind, aber war und ist längst vorhanden. Es ist das Gesetz der Schöpfung, in dem der Wille Gottes zum Ausdruck kommt. Dieses der Menschwerdung zugrundeliegende Gesetz enthält die sich wiederholende, verkleinerte Nachbildung jenes großen Entwicklungsprozesses, der überhaupt zum Auftreten des Geschöpfes »Mensch« auf dieser Erde geführt hat. Es erscheint deshalb angezeigt, zunächst dieses Größere zu betrachten, das sich im Kleineren nur nachfolgend spiegelt. Fragen wir also, den Titel dieser Betrachtung abwandelnd und erweiternd: Wie entstand der Mensch?
Seit Darwins Lehre von der Entstehung der Arten stehen sich die Meinungen gegenüber, klafft ein unüberbrückter Gegensatz zwischen Glaube und Wissenschaft: Die einen folgern aus dem biblischen Schöpfungsbericht, der Mensch sei als solcher fertig erschaffen worden, die anderen leiten aus dem organischen Aufbau der Pflanzen- und Tierwelt die Ansicht ab, auch der Mensch sei als Ergebnis der Evolution aus der Artenentwicklung hervorgegangen. So sehr diese Ansicht durch die Forschung auch gestützt erscheint – an der Nahtstelle zwischen Tier und Mensch läßt sich das letzte, verbindende Glied noch immer nicht erkennen.
Jede der beiden Auffassungen enthält, wie dies bei Widerstreit meist der Fall ist, einen Teil der Wahrheit. Um das Folgende richtig verstehen zu können, müssen wir uns allerdings zwei unbestreitbare, einfache Grundwahrheiten wieder bewußtmachen; Grundwahrheiten, die der Mensch nur allzu leicht bereit ist, bei seinen Überlegungen zu vergessen.
Die Bedeutung der Strahlungsbrücke
Zunächst: Alles in der Welt beruht letzten Endes auf Strahlung. Die Physik hat uns bereits die Gewißheit verschafft, daß alles Wellen aufnimmt, umwandelt, aussendet – also strahlt. Darauf beruhen alle chemischen Reaktionen, Farben, Töne, die Erscheinungen. Die ganze uns sichtbare und unsichtbare Welt ist nichts anderes als eine unbegreiflich vielfältige Abwandlung von Strahlungen. Daraus ergibt sich ein Strahlungsnetz, von dem unsere Sinnesorgane nur einen verschwindend geringen Teil zu erfassen imstande sind.
Wie sehr auch der Mensch als Empfänger und Sender in dieses Netz eingebunden ist, können wir – um nur einige Beispiele zu nennen – aus den Veränderungen unseres körperlichen und seelischen Zustandes durch Strahlungseinflüsse ersehen, aus dem Gehirnstrom (der ja nichts anderes ist als eine körpereigene Strahlung), aus der Wärmestrahlung (die bereits zu diagnostischen Zwecken ausgewertet wird) und anderem mehr. Diese Tatsache gilt es im Auge zu behalten, wenn im folgenden wiederholt von Strahlungen und ihrer Bedeutung auch für das hier zu behandelnde Geschehen gesprochen wird. Der Hinweis auf solche Strahlungen darf daher nicht befremdlich erscheinen; er führt die Dinge nur auf ihre eigentliche Ursache zurück.
Die zweite, hier zu beachtende Grundwahrheit ist: Wenn Neues entstehen soll, muß stets ein bestimmter Reifezustand des Vorherigen gegeben sein, an den das Neue anschließen kann. Ich will dafür ein einfaches, sehr handfestes Beispiel geben: Wenn man ein Haus errichtet (freilich nicht aus Fertigteilen), so müssen zunächst die Wände stehen, ehe man die Installationen anlegen kann. Diese sind von ganz anderer Art als die Wände, haben mit diesen nichts gemein, doch die Verbindung der beiden führt zu einem Fortschritt des Baues, den zu erreichen die Wände allein nicht vermocht hätten. Was uns bei solchem menschlichen Tun ganz selbstverständlich erscheint, gilt auch für die Natur, für die ganze Schöpfung. Auch im Bereich des Lebendigen ist es nicht anders: Nur unter bestimmten Voraussetzungen ist der Boden bereit, der Saat die für ihr Gedeihen nötige Grundlage zu bieten; die Blüte muß entfaltet sein, um durch die Bestäubung zur Frucht zu gelangen; das Ei muß gereift sein, um befruchtet zu werden. Die Beispiele ließen sich zahllos vermehren, jeder wird weitere finden.
Wir brauchen diese beiden aufgezeigten Grundwahrheiten nur zu verbinden, um den Schlüssel zu erhalten zum Verständnis der hier zu behandelnden Vorgänge. Denn der besondere Zustand, von dem eben die Rede war, bringt ja eine bestimmte, diesem Zustand entsprechende, mit ihm unvermeidlich einhergehende Ausstrahlung mit sich. Darin liegt das Geheimnis aller Entwicklung.
Es sollte also klar sein, daß die Entstehung alles Geschaffenen auf dieser Erde – von den ersten Eiweißverbindungen über die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt – eine ständige Abwandlung von Ausstrahlungen war. Jede dieser Ausstrahlungen bildete ihrerseits den »Schlüsselreiz«, um aus der Fülle des in der alles umfassenden Schöpfungskraft Bereitliegenden jene Strahlung »abzurufen« und damit ihre erdenstoffliche Formung zu ermöglichen, die ihr am nächsten kam und für welche sie solcherart die Brücke zu bilden geeignet war. Ähnliches ist ja auch heute immer noch zu beobachten: Hausfrauen können es zum Beispiel erleben, daß bei längerer Einlagerung von Lebensmitteln wie Mehl, Eingemachtem oder dergleichen Kleinlebewesen zum Dasein gelangen, die vorher nicht vorhanden waren. Die Bedingungen der Einlagerung haben ihnen die Möglichkeit dazu geschaffen. Sie bewirkten eine Veränderung der Zusammensetzung und damit der Ausstrahlung, so daß, was bisher nur keimhaft bereitlag, in Erscheinung treten konnte. Wenn etwa nach den Spielregeln von den noch verdeckten Dominosteinen nur jener angesetzt werden darf, der dem letzten, schon vorhandenen Stein entspricht; wenn etwa aus der Fülle der in einem Computer gespeicherten Daten durch eine bestimmte Fragestellung gerade jene abgerufen werden, die dieser Frage entsprechen, so handelt es sich nur um willkürliche oder technische Nachbildungen derartiger »Schlüsselreize«, die im Bereiche des Lebendigen eben durch die Ausstrahlung gebildet werden. Hoimar von Ditfurth kommt dem schon sehr nahe, wenn er – als Wissenschaftler – einräumt (in »Zusammenhänge«, Verlag Hoffmann & Campe, Hamburg):
»Das ›tote‹ Wasserstoffatom enthält bereits alle Informationen, die erforderlich waren, um unter den Bedingungen der Naturgesetze alles entstehen zu lassen, was existiert. Das ist vielleicht die großartigste Perspektive unseres heutigen Weltbildes.«
Gewiß spielen bei der Artenentstehung nach außen hin auch Mutation (Abwandlung) und Selektion (Auswahl des Bestangepaßten) eine Rolle, aber sie nehmen gewissermaßen nur die »Weichenstellung« vor für das jeweilige Zustandekommen jener veränderten Ausstrahlung, die dann eine neue Strahlungsbrücke bildet.
Das Erscheinen der Menschheit
Mit dem Hervorbringen des dem Menschen am nächsten kommenden Tierkörpers, eines in seiner Art höchstentwickelten Menschenaffen, hatte die »Natur« den gestalterischen Höhe- und Endpunkt ihrer Möglichkeiten erreicht. Hier müssen wir uns nun klarmachen, daß die ganze Schöpfung aus zwei Grundarten besteht, von ihnen durchzogen wird: dem Wesenhaften und dem Geistigen. Die in der Natur tätigen Geschöpfe gehören der wesenhaften Grundart an. Ihr formenbildend-belebendes Schaffen können wir zumeist nur in seiner Auswirkung erkennen, weil die zartereBeschaffenheit dieser Wesen für unsere nur Gröberem geöffneten Sinneswerkzeuge nicht faßbar ist. Sie verwirklichen den für die Wissenschaft unerklärlichen Plan, der allem natürlichen Geschehen zugrunde liegt. Das Wesenhafte handelt nämlich stets nach dem Gesetz der Schöpfung, das heißt nach dem Gotteswillen.
Das Wesenhafte hatte also den Endpunkt der ihm arteigenen Möglichkeiten erreicht: Es hatte Pflanzen und Tiere, kurz, alles hervorgebracht, was wir im weitesten Sinne unter »Natur« verstehen. Sollte die Entwicklung nicht stehenbleiben (und dies tut sie niemals), so mußte Neues hinzutreten. Neues aber konnte nur noch die andere große Schöpfungsart bringen: das Geistige.
Auch dessen Eintritt in die Erdenwelt vollzog sich streng nach der vorhin aufgezeigten Gesetzmäßigkeit, wonach nur Ähnliches die Strahlungsbrücke für das weiter in Erscheinung Tretende bilden kann. Der höchstentwickelte Tierkörper des Menschenaffen bot diese Voraussetzung, denn das Reifste des Wesenhaften kommt dem Niedrigsten des Geistigen am nächsten, ähnlich wie sich zwei übereinanderstehende Kreise in einem Punkte berühren. Und die mit dieser Ähnlichkeit einhergehende Ausstrahlung bildete die Brücke für den Eintritt des Geistes, ermöglichte dessen Angliederung.
So wurden nach einem Zeugungsakte solcher Tiere da und dort an Stelle einer Tierseele Geistkeime angezogen und belebten die Frucht. Das war der für die Wissenschaft nicht faßbare Beginn des erdenmenschlichen Daseins: die Inkarnation – die Einverleibung – des Geistigen in eine irdische Körperlichkeit. Es ist jenes Ereignis, das mit dem »Einhauchen des Atems Gottes« umschrieben wird: Der Funke des Unstofflichen wurde mit dem Stoffe verbunden.
Hier freilich ist der Punkt, an dem sich – im wahrsten Sinne des Wortes – »die Geister scheiden«. Denn es gibt Menschen, die den grundlegenden Unterschied zwischen der Seele des Tieres und dem Geiste des Menschen – die zwei verschiedenen Schöpfungsarten angehören – nicht erkennen wollen. Sie erachten sich selbst nur als weiterentwickeltes Tier. Doch ihre Haltung entspringt nicht der (vorgetäuschten) Demut, die es ablehnen will, etwas »Besseres« zu sein, sie ist vielmehr ein Sich-Verschließen vor der Wahrheit, deren sie nicht zu bedürfen glauben.
Ein fernes Ahnen dieses großen Geschehens findet sich auch heute noch bei manchen Naturvölkern. So gibt es etwa in Indonesien eine Schöpfungslegende, wonach einst zwei Affen aus dem Urwald gekommen seien. Einer davon habe sich zum Menschen entwickelt, der andere sei in den Wald zurückgekehrt. Darin kommt genau jene Höherentwicklung zum Ausdruck, die jener Teil des dazu vorbereiteten Tieres beginnen konnte, der mit dem Geistigen befruchtet worden war. Denn der Hinzutritt eines fördernden Neuen ist – losgelöst von allem Geschlechtlichen – stets ein Akt der Befruchtung.
So also war das Geistige, ihr von seinem Ursprung her nicht zugehörig, in diese Erdenwelt eingetreten. Es konnte sich zwar des von den wesenhaften Baumeistern entwickelten Gefäßes, eines tauglichen Körpers, bedienen, mußte jetzt aber seine eigene Entwicklung beginnen. Denn das Niedrigste des noch bewußtseinsfähigen Geistigen, das der Mensch in sich trägt, ist nur ein Geistkeim, ein geistiges Samenkorn, entwickelungsbedürftig. Erst die Erkenntnis seiner Aufgabe im Schöpfungsganzen und der ihm zu ihrer Erfüllung geschenkten Fähigkeiten ermöglicht es dem Menschengeiste, vollbewußt heimkehren zu können in den seiner Art entsprechenden geistigen Teil der Schöpfung. Dazu bedarf es der vorherigen Reifung in der irdisch-stofflichen Dichte. Sie zwingt ihn zum Tätigsein und zur Wachsamkeit und hat dadurch weckende Wirkung. In der Inkarnation des Geistes auf Erden liegt also ein zweifacher Sinn: Im Zuge der eigenen Bewußtseinsentfaltung soll er, seiner Art nach das von der Natur Erreichte überragend, dieses stützend weiterführen und damit dem Grundgesetz der wechselseitigen Förderung dienen, das der ganzen Schöpfung zu eigen ist.
In seinen Anfängen war der Geistkeim aber noch dumpf, seiner selbst kaum bewußt. Langsam erst mußte er sich in dieser ihm fremden Erdenwelt zurechtfinden, die ja nur den hilfreichen Boden für sein Reifen abgeben sollte. Das verwischt die Übergänge zwischen Tier und Mensch und erweckt fälschlich den Anschein, als handle es sich auch hier nur um einen aus der schon vorhandenen Art weitergeführten Zweig der Evolution. Denn das hinzugekommene Neue, das Geistige, zeigte erst allmählich seine verändernde Wirkung. Daher ist die Wissenschaft kaum in der Lage, die verschiedenen Knochenfunde zuzuordnen: Wer war noch Tier? Wer war schon Mensch?
Jeder Weltenkörper freilich kann nur einmal, während der begrenzten Zeit der entsprechenden Entwicklungsreife, durch Geistkeime, wie geschildert, befruchtet werden. Ist diese Gelegenheit zur Verbindung vorüber, so sind dort – wie dies auch auf der Erde längst schon der Fall ist – in weiterer Folge nur noch Wiedergeburten, das heißt weitere Erdenleben solcher Menschengeister möglich, die hier schon zur Inkarnierung gelangt waren. Ähnliches finden wir ja auch im Kleinen wieder: Die Befruchtung eines Eies kann im Kreislauf des Werdens, Reifens und Vergehens nur während seiner Reife erfolgen.
Das Werden des Einzelmenschen
Damit kehren wir wieder zurück zum Ausgangspunkte unserer Betrachtung, zum Werden des einzelnen Menschen. Denn die Zeugung, die manche als den Beginn des erdenmenschlichen Lebens ansehen, gibt nur den Anstoß zur Bildung der Körperhülle, deren sich der Geist in seinem künftigen Erdenleben bedienen kann. Sie löst, im Wirkungsbereich des den Stoff belebenden Wesenhaften bleibend, jenen Prozeß aus, der – bezogen auf die einstige Menschheitsentstehung – der Heranbildung des zur geistigen Befruchtung bereiten Tierkörpers entspricht. So bildet in diesem ersten Abschnitt des Werdens der Embryo auch jetzt noch kurzzeitig Andeutungen von Kiemen, dann eines Lurchschwanzes und schließlich eines Fellkleides aus. Er wiederholt für sich im Zeitraffertempo die Vorgeschichte seiner Entwicklung im Tierreich, an die sich erst das Geistige anschließen konnte.
Für die meisten Menschen sind, da sie sich nur an das Stofflich-Sinnenhafte halten, Zeugung und Geburt die Pole der Menschwerdung. Das bedeutungsvollste Geschehen aber liegt dazwischen: die Inkarnation. Sie ist die Verbindung des Geistes mit dem in Entwicklung befindlichen Erdenkörper. Dazu ist es erforderlich, daß dieser bereits eine gewisse Reife erreicht hat, eine Reife, die zugleich den Höhepunkt dessen bildet, was wesenhaftes Wirken aus sich allein hervorbringen kann. Dieser Zustand ist etwa in der Mitte der Schwangerschaft gegeben. Er geht einher mit einer bestimmten Stärke der Ausstrahlung des bisher geformten Gebildes, und über die Brücke dieser Ausstrahlung kommt es zum Eintritt des Geistes.
Freilich: Die Inkarnation spielt sich im Verborgenen ab. Die Wissenschaft nimmt sie, da Geistiges sich stofflich nicht fassen läßt, nicht zur Kenntnis. Und doch sind die hierdurch bewirkten Veränderungen auffällig, denn jetzt setzen die Herztöne des Kindes ein und die Bewegungen des Kindeskörpers werden als Ausdruck eigenen Lebens für die Mutter deutlich spürbar. »Das Kind erwacht«, pflegt man zu sagen. Wie recht hat man doch mit dieser aus der Empfindung geformten Bezeichnung! Auch die Wissenschaft kann sich dem nicht mehr verschließen. So schreibt Dr. med. Thomas Verny (»Das Seelenleben des Ungeborenen«, Verlag Rogner und Bernhard, München 1981):
»Vor ein oder zwei Jahrzehnten hätte man die Vorstellung, daß ein sechs Monate alter Fetus ein Bewußtsein besitzen soll, lächerlich gefunden. Heute betrachten das viele als allgemein akzeptierte Tatsache […]
Irgendwann im zweiten Schwangerschaftsdrittel ist der Fetus so weit entwickelt, daß – nach meiner Ansicht – in dieser Zeit auch sein Ich zu funktionieren beginnt […]
Die Beweise für eine Art außerneurologisches Gedächtnissystem sind zu zahlreich, als daß die Wissenschaftler, die unvoreingenommen und bereit sind, für alle die beobachtbaren Phänomene eine Erklärung zu finden, sie ignorieren könnten […]«
Dieses »außerneurologische Gedächtnissystem« aber ist nichts anderes als der jetzt bereits mit dem Fetus verbundene und als solcher wahrnehmungsfähige Geist. Die dadurch bewirkte Veränderung schildert Margret Shea Gilbert in »Biographie eines Ungeborenen« (»Das Beste« 11/62) wie folgt:
»Jetzt wird das Tempo der Entwicklung, die seit der Empfängnis so ruhig verlaufen ist, lebhafter. Der Fetus regt sich, streckt sich, stößt mit Armen und Beinen. Seine ersten Bewegungen kommen der Mutter noch wie ein schwaches Flattern vor. Nicht lange aber und seine Stöße gegen die Gebärmutter verraten ihr unmißverständlich, daß das Leben bei ihr anpocht.«
Diese Worte treffen genau den Kern, denn jetzt ist das werdende Gebilde in bestimmungsgemäßer Weise belebt. Und die Verbindung mit dem Geiste gestattet nun die zügige Weiterentwicklung des bisher nur Vorgeprägten zum Menschen, die mit der Geburt ihren Abschluß findet.
Der Mensch ist geboren – doch noch nicht fertig
Es wäre aber irrig zu meinen, die Menschwerdung sei damit beendet. Abgelaufen ist nur jener Teil davon, der sich in der schützenden Geborgenheit des Mutterleibes vollzogen hat. Noch ist das junge Geschöpf hilfe- und pflegebedürftig. Nach und nach erst beginnt es seinen engsten Umkreis – zunächst sogar im ganz wörtlichen Sinne – zu erfassen. Später werden ihm allmählich Blumen, Tiere, kurz, die Natur vertraut. Diese den Mühen des Erdenlebens noch weitgehend entrückte Unfertigkeit ist es, die sein Kindsein ausmacht. In gedrängter Form durchläuft das Kind auf diese Art die Frühstufen der Menschheit, setzt also die im Mutterleib begonnene Wiederholung der Entwicklungsgeschichte, nun schon als Geistgeschöpf, fort. Noch hat es, so wie einst die ersten zur Inkarnation gelangten Geistkeime, die Erdenwelt nicht voll im Besitz. Zunächst ist es im Begriffe, ihren wesenhaften Teil, das Wirken der Natur, zu erleben. Doch der Zeitpunkt kommt, an dem sich dies deutlich ändert: es ist der Eintritt der geschlechtlichen Reife. Jetzt erst schließt sich der Kreis: Das neue Geschöpf hat nun selbst jene Befähigung erlangt, die es seinen Eltern ermöglichte, sein neues Erdenleben einzuleiten.
Die damit gewonnene Zeugungsfähigkeit aber ist nur ein Zeichen dafür, daß der Mensch nun imstande ist, schaffend in die Stofflichkeit hineinzuwirken. Dieses Schaffen beschränkt sich aber nicht auf das Geschlechtliche. Die Kraft, die ihm jetzt zugewachsen ist, ist die Lebenskraft schlechthin. Sie ist ab nun gegenwärtig in allem seinem Tun, sie ist der Schlüssel, durch den ihm erst das Tor geöffnet wird in die Erdenwelt.
Erst durch die Gralsbotschaft wurde die eigentliche Bedeutung der Sexualkraft geklärt (GB »Die Sexualkraft in ihrer Bedeutung zum geistigen Aufstiege«):
»Das ist der Hauptzweck dieses rätselhaften, unermeßlichen Naturtriebes! Er soll das Geistige in dieser Stofflichkeit zu voller Wirkungskraft entfalten helfen! Ohne diese Sexualkraft wäre es unmöglich, aus Mangel eines Überganges zur Belebung und Beherrschung aller Stofflichkeit. Der Geist müßte der Stofflichkeit zu fremd bleiben, um sich darin richtig auswirken zu können.«
Das wird leicht einsehbar, wenn wir uns der entscheidenden Rolle entsinnen, die in allen Lebensvorgängen der Ausstrahlung zukommt. Auf ihr beruht die von allen Naturwissenschaften bereits anerkannte Wechselwirkung, die vom Kleinsten bis zum Größten zwischen allem Geschaffenen besteht: Es ist ein Hinauswirken durch die der eigenen Art entsprechenden Wellen und ein Geöffnetsein für die von außen kommenden Einflüsse. Diese Ausstrahlung wirkt als Sender wie als Filter; Verbindung erlangt nur, was auf gleicher oder zumindest ähnlicher Welle schwingt. Der noch unreife Erdenkörper schirmt daher den Geist gegenüber der irdischen Umwelt ab. Er ist ja noch nicht imstande, die ganze »Bandbreite« ihrer Ausstrahlungen aufzunehmen, da er dieser infolge seiner Unfertigkeit noch nicht gleichartig ist, sie noch nicht in sich trägt. Er verfügt vorerst nur über einen »Frequenzbereich«, der dem dem Geistigen untergeordneten Wesenhaften entspricht. Erst nach und nach vergrößert sich seine Spannweite, bis sie mit der erlangten körperlichen Reife ihren vollen Umfang erhält. Dadurch und jetzt erst ist der Geist mit der Erdenwelt voll verbunden und befähigt, als solcher in ihr zu wirken, aber auch ihre Wirkungen zu empfangen. Da es aber das Wirken des Geistes ist, des ureigensten Kernes des Menschen, das ihn erst zum Menschen macht, ist auch die Menschwerdung erst zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen.
Ohne um die wahre Ursache zu wissen, trägt auch der Gesetzgeber diesem entscheidenden Umstand Rechnung: er entzieht den stufenweisen Schutz, den er zunächst dem Unmündigen und dann dem Minderjährigen gewährte. Mit erreichter Volljährigkeit – und dies meint ja nichts anderes als erlangte Reife – wird der Mensch zwar eigenberechtigt, aber auch voll verantwortlich. Jetzt ist er »erwachsen«, ist mit allen Rechten und Pflichten vollwertig geworden, vor dem Gesetz wie auch in der Schöpfung. ...
»WAS IST DAS ÜBERHAUPT – EINE FRAU?«
Dort, wo der Mann nicht aufzublicken fähig ist zum Weibe in deren Weiblichkeit, vermag keine Nation, kein Volk emporzublühen!
Da helfen nicht Gesetze oder neue Formen mehr. Die Rettung liegt allein in dem Begreifen aller Schöpfungsurgesetze.
Mehr denn je ist in dieser Zeit die Frau auf der Suche nach sich selbst. Von vielen Seiten ist man bestrebt, sie in die Gesellschaft neu einzuordnen, wobei das Verlangen nach Modernität auch die Geschlechter verändern möchte. Doch weil dies gerade durch solche geübt wird, die selbst nicht die Grundbedingungen kennen, soll hier der Versuch unternommen werden, an Hand der Gralsbotschaft der Frau ein Selbstverständnis zu geben. Die Frage ist, ob ich als Mann denn überhaupt dazu geeignet bin. Bedenken Sie aber, daß sich kein Mensch zur Gänze selber beschauen kann. Jeder bedarf dazu eines Spiegels. So ist der Mann in der Ordnung der Schöpfung der Frau direkt gegenübergestellt. Indem er ihr Bild im Abstand empfängt, wird das Erkennen des Ganzen ihm leichter, weil Rechtes wie Falsches ihn mitbetrifft. Er kann durch das Verhalten der Frau hinabgedrückt oder beflügelt werden.
Die Frau aber wird im verwirrenden Schwalle der um sie besorgten Berater sich nur durch das Wissen um ihre Herkunft und ihre Daseinsbestimmung behaupten. Sie muß sich von falschen Begriffen lösen und die Verbindung zum Ursprung finden. Dazu ist ein weiteres Ausholen nötig, – denn bei Behandlung von Frauenproblemen bleibt meistens das Wichtigste ungesagt. Legen Sie aber das Heft nicht beiseite, wenn auch manches, das Sie hier hören, Ihnen neu und befremdlich erscheint. Prüfen Sie doch, ob dieses Befremden etwas gegen die Richtigkeit sagt. Gibt es nicht eher erschreckendes Zeugnis der Gleichgültigkeit, mit welcher die Menschen die wichtigsten Daseinsfragen behandeln? Selbst die Verschiedenheit der Geschlechter wird oft gedankenlos hingenommen, von manchen sogar als Laune des Schöpfers, die noch durch uns der Verbesserung harrt.
Die Entstehung der Weiblichkeit
Wie kommt es nun zu den Erscheinungsformen des Männlichen und der Weiblichkeit? Dies zu klären ist vorweg geboten, weil sich daraus die Notwendigkeit der klaren Unterscheidung ergibt.
Sie haben gewiß schon davon gehört, daß mitunter begnadeten Menschen das Bild einer himmlischen Frau erschien. Man hat sie als Maria gedeutet, als die irdische Mutter Jesu, weil man von dieser Kenntnis hatte, von jener hingegen, die hier im Abbild aus ewigen Fernen gezeigt worden war, nur durch höchste Kündung erfahren konnte: Elisabeth – die aus der Ausstrahlung Gottes als Erste Form gewinnend hervorging und als der Inbegriff weiblichen Wirkens die Brücke für alles Entstehende ist.
An allererster, an höchster Stelle steht also eine Frauengestalt. Liegt darin nicht schon ein deutlicher Auftrag an alles Weibliche, wo es auch sei?
Denn Weibliches muß auch in weiterer Folge immer wieder die Brücke bilden, wenn Neues werdend entstehen soll. So kann selbst hier in der Erdenwelt kein Geschöpf in das Dasein treten, würde Weibliches ihm nicht zuvor die Form für dieses Leben bereiten. Hier, bei der Bildung der stofflichen Körper, aber wirkt sich nur sichtbar aus, was Grundgesetz alles Weiblichen ist: geöffnet-spendendes Bindeglied in der Kette des Lebens zu sein; eine Aufgabe, die im Geistigen wurzelt und deshalb das Stoffliche mit erfaßt.
Denn die Verschiedenheit der Geschlechter, die sich bis in die Körper ausprägt, wird durch die Art ihres Wirkens bestimmt. Wirken: das heißt, seine Fäden schlagen von sich aus zu anderen, gebend, empfangend, in nimmerendender Wechselbeziehung, und erst aus dem Wirken aller Geschöpfe entsteht jenes Daseins- und Schicksalsgeflecht, das dann für jeden die Wirk-lichkeit ist.
Dieses Wirken ergibt sich nicht, wie neuerdings manchmal behauptet wird, als »anerzogenes Rollenverhalten«, es ist in den Schöpfungsgesetzen verankert, die jedem Geiste die Wahl überlassen.
Wir alle kennen ja aus der Physik den magnetischen Süd- oder Nordpol und Gegenpole der Elektrizität. Wir können forschen, wo immer wir wollen – überall werden wir ähnliches finden. Die Aufspaltung in die Polaritäten ist der gesamten Schöpfung zu eigen. Sie wird von zwei Arten durchzogen, getragen. Das Spannungsfeld der sich ergänzenden Kräfte hält allen Bau der Welten zusammen und ist auch die Ursache ihrer Bewegung.
Die eine Grundart ist spendend, betreuend. Die Gralsbotschaft spricht hier von »wesenhaft«. Wir finden sie in der irdischen Umwelt vor allem in der gesamten Natur. Die andere Grundart, das Geistige, dem auch der Menschengeist zugehört, ist seinem Wirken nach aktiv gestaltend. Innerhalb jeder der beiden Arten und aller ihrer Erscheinungsformen wiederholt sich nun abbildhaft diese Aufspaltung immer aufs neue. So gibt es auch in der geistigen Grundart passive und aktive Teile, die ihrerseits mehr oder weniger stark mit dem Wesenhaften verbunden sind. Die Frau gehört zu der ersteren Gruppe.
Es ist nun nicht etwa ein Spiel des blinden Zufalles, welches Geschlecht ein jeder erhält. Denn jedes Geschöpf, auch der Geistkeim des Menschen, entwickelt – und sei es auch unbewußt – im Augenblick seines Erwachens zum Dasein den Drang zu einer der Arten des Wirkens. Diese Entscheidung erfolgt für den Menschen lange schon vor seiner Erdgeburt, in fernen, höheren Schöpfungsstufen, in denen er noch nicht verbleiben kann, da er wie jeder andere Keimling vorerst der Reifung im Stoffe bedarf, um, was in ihm an Möglichkeit schlummert, in seiner Art zur Entfaltung zu bringen.
Will der zum Aktiven neigende Geist nun sein Verlangen reifend erfüllen, drängt es von selbst ihn tiefer hinein in diesen stofflichen Schöpfungsteil. Im Zwange der notwendigen Selbstbehauptung läßt er dabei aus der Schöpfungskraft von sich aus die zarteren Teile zurück; sie lösen sich, da er sie nicht benötigt, selbsttätig ab und verbleiben dem Weibe. Dies alles geschieht in natürlicher Folge unschaubar für den menschlichen Geist, einzig auf Grund des erwachenden Wunsches nach der entsprechenden Tätigkeit.
Wenn die Bibel hierzu berichtet, daß Eva aus Adams Rippe entstand, so wird uns damit dieser Vorgang geschildert. Es kommt die größere Zartheit der Frau in diesem Gleichnis dadurch zum Ausdruck, daß schon ein Teil aus der Dichte des Mannes für die Erschaffung des Weibes genügt.
Das alles mag Ihnen vielleicht zu abstrakt, jenseits des Vorstellbaren erscheinen; aber dem ist im Grunde nicht so. Nehmen Sie an, Sie bauen ein Haus. Indem Sie seine Wände errichten, entsteht auch unvermeidlich ein Zweites: der Innenraum, der sich dazwischen befindet. Ebenso wie das Baumaterial für die stofflich faßbaren Wände war auch er vom Beginn schon vorhanden, jedoch noch vermengt und unabgegrenzt, als eigenes Etwas noch nicht bestehend. Mit der Errichtung des Baues aber, dem schöpferischen, gestaltenden Akt, traten beide zugleich in Erscheinung, das eine durch das andere entstehend und Zartes vom Groben schützend umhüllt.
So sind schon vor ihrem Erdenleben der männliche und der weibliche Geist durch Schöpfungsgaben verschieden gewichtet. Diese ihre Beschaffenheit ist es, die dann den passenden Körper verlangt, weil ja der Geist sich den Körper bildet. So ist die Frau auch im Erdenkörper der irdischen Schwere etwas entrückt, denn das leichter Beeindruckbare, das dem weiblichen Geiste verblieb, steht der nächsthöheren Schöpfungsstufe artgemäß näher als männliche Stärke. Die Frau wird so zur Brücke nach oben in die verfeinerten Schöpfungsregionen.
Sie werden dies sicher noch leichter verstehen, wenn Sie sich einen Baum vorstellen. Da gibt es Blätter, Zweige und Äste und schließlich den Stamm mit den zahlreichen Wurzeln. All dies ist von dichter Grobstofflichkeit – und doch gestuft vom Zarten zum Groben. Während der Stamm in dem Erdreich wurzelt, um daraus die Nährstoffe zu gewinnen, wenden die ungleich zarteren Blätter sich dem Ungreifbaren entgegen und bringen so jenes Wunder zustande, das man als Photosynthese bezeichnet: Aus dem Lichte Kraft aufzunehmen und sie, ins Stoffliche umgewandelt, zum Nutzen des Ganzen weiterzugeben.
Das ist die Sendung auch der Weiblichkeit! Ihr Geist ist zum Empfang des Lichts bereitet.
Die Eigenschaften der Weiblichkeit
Auf Grund der Beschaffenheit ihres Geistes sollte die Frau in der Lage sein, all das zu schönster Entfaltung zu bringen, was sie vor dem Manne auszeichnen soll. Da ist allem voran die Reinheit. Sie tritt uns irdisch als Keuschheit entgegen. Für den Menschen von heute hat dieser Begriff nahezu jeden Inhalt verloren, so sehr hat die Entfernung davon und die Ersetzung durch falsche Deutung das wahre Bild der Keuschheit verhüllt. Sie steht weit außerhalb jener Verengung, die sie auf Körperliches bezieht. Keuschheit ist dem Geiste zu eigen, umfaßt sie doch schlechthin jegliches Denken, und dadurch erst spannt sich lebendig die Brücke zwischen der Frau und der höheren Welt. So stellt die reine Keuschheit des Geistes sich zwanglos zugleich als Kindlichkeit dar. Nicht einfältig ist sie, sondern nur einfach, schlicht geöffnet für Wahres und Schönes.
Das geringere Interesse der Frau für die verstandesmäßigen Wissensgebiete beruht nicht auf unterlassener Bildung, es wurzelt tief in dem weiblichen Wesen. Verstandesmäßiges dient nur dem Irdischen; sie aber weiß – viel mehr als der Mann – um die beglückenden höheren Werte, so daß die Bedeutung des Erdverstandes ihr nicht so groß wie dem Manne erscheint. Ihr Geist, der zarteren Höhen zustrebt, gewinnt dadurch die natürliche Anmut, die niemals – so wie äußere Schönheit – nachzuahmen versucht werden kann. Dem innersten Kerne des Menschen entstammend, kann sie nur echt sein und niemals trügen.
Diese Eigenschaften der Frau wirken anziehend auf den Mann. Auch sein gröberes, erdnahes Schaffen wird solcherart durch die Frau veredelt. Dem hat Rainer Maria Rilke in der »Weise von Liebe und Tod« ergreifend-wahre Gestaltung gegeben:
»Denn nur im Schlafe schaut man solchen Staat und solche Feste solcher Frauen: Ihre kleinste Geste ist eine Falte, fallend in Brokat. Sie bauen Stunden auf aus silbernen Gesprächen, und manchmal heben sie die Hände so –, und Du mußt meinen, daß sie irgendwo, wo Du nicht hinreichst, sanfte Rosen brächen, die Du nicht siehst. Und da träumst Du: Geschmückt sein mit ihnen und anders beglückt sein und Dir eine Krone verdienen für Deine Stirne, die leer ist …«
Man muß diese Verse aufblühen lassen, denn selten nur hat in der Literatur der zarte und erhebende Zauber, den Weibliches zu verbreiten vermag, ähnlich vollendeten Ausdruck gefunden. Die unerfüllte Sehnsucht des Mannes formt sich zur Klage in der Erkenntnis, der wahren Frau nur im Traum zu begegnen, wenn, von der Schwere des Körpers gelockert, der Geist in lichte Gefilde entschwebt. Nichts macht erhabene Anmut so deutlich, wie eine »Falte, brokaten fallend«, die hoheitsvoll in Natürlichkeit jede Bewegung fließend umkleidet. Fernab irdischer Banalität liegt auf den »Gesprächen aus Silber« der Abglanz einer lichteren Welt. Daß die Frau in Höhen hinaufreicht, die dem Manne verschlossen sind, wird durch die Rosen zum Ausdruck gebracht, die als Geschenk von drüben erscheinen. Sie wecken das Sehnen, würdig zu werden der Beglückung aus jenem anderen Reich und beflügeln den edelsten Tatendrang. Denn nur der stumpfe, verrohte Mann fühlt in sich nicht starkes Verlangen, schützend die hohen Werte zu hegen – wenn ihm seit je die Geschlechter gewogen.
So ist die Wirkung wahren Frauentums: es weckt die reine Sehnsucht nach dem Licht.
Die weiblichen Hauptaufgaben
Ein weitgespanntes Betätigungsfeld öffnet sich jeder wirklichen Frau: Alles Betreuende, Hegende, die Heranführung zu den inneren Werten entspricht – im weitesten Sinne verstanden – der Neigungsrichtung des weiblichen Geistes. Vor allem aber erscheint sie berufen, Gattin, Hausfrau und Mutter zu sein. Diese besonderen Wirkungskreise sollen hier näher betrachtet werden, weil mangelnde Kenntnis der Schöpfungsgeschichte selbst diese Grundbegriffe verzerrte.
Die Gattin:
Vorerst gilt es die Kraft zu erkennen, die die Geschlechter zusammenführt, die eines das andere suchen läßt. Liebe ist viel zu allgemein, um eine Erklärung dafür zu geben. Sie kann, nicht an den Körper gebunden, sondern ihn letztlich nur einbeziehend, alles und jedes in sich schließen, vom Unscheinbarsten der ganzen Schöpfung bis zu Gott selbst, der die Liebe
ist.
Es hängt die Bindekraft der Geschlechter aufs engste zusammen mit deren Entstehung. Vom Strome des Geistigen abgespalten und auf Grund ihres freien Entschlusses mit unterschiedlichem Rüstzeug versehen, tragen sie in sich das Anschlußverlangen nach dem ergänzenden anderen Teil. In dieser Ergänzung liegt das Geheimnis der schöpfungsgesetzlichen Partnerschaft.
Denn was sich ergänzend zusammenschließt, belebt und fördert sich wechselseitig. Das ist nicht beschränkt auf die Aufgabenteilung, auf irdischen Beistand oder Versorgung; es gilt in erster Linie dem Geiste und soll dessen Aufstieg hilfreich erleichtern. Denn werden in liebevoller Begegnung Selbstlosigkeit, Verständnis und Rücksicht zu freudig geübter Tugend entwickelt, gewinnt das Bestreben, sich zu veredeln, genährt durch beglückende Wechselwirkung von selbst bei beiden Partnern Gestalt.
Und um so mehr wird sich in der Gemeinschaft der Daseinszweck von Frau und Mann erfüllen, je klarer dann die beiden Ehegatten das hohe Ziel des Weges vor sich sehen und gleichem Gott ihr Leben dankbar weihen.
Um Förderung zu bieten, zu erfahren, genügt schon der Gedanke an den anderen. Die Frau kann durch ihr Dasein Rohes dämpfen und Edles in den Menschen auferwecken, auch ohne daß persönliche Begegnung und irdische Verbindung nötig wären.
Die Ehe freilich bietet ganz besonders Gelegenheit zu ständiger Bewährung. Sie soll das geistige Versprechen sein, gemeinsam aufwärts nach dem Licht zu streben. So wie das Waagrechte und Senkrechte, das Passive und Aktive verkörpernd, im Mittelpunkt des Kreuzes sich berühren, schweißt das Gelöbnis beide Ehegatten in ihrem Innersten, dem Geist, zusammen, damit des Lichtes hoheitsvolles Zeichen in ihrem Bund zur Erdenwahrheit wird.
Das mag vielleicht idealisiert erscheinen, wenn man die Ehen, wie sie sind, betrachtet. Und doch kann dieses Bild verwirklicht werden, wenn sich der Mensch nicht selbst im Wege stünde, indem – das Ziel im Geistigen verleugnend – er Irdischem allein Bedeutung gibt. Daraus entspringt der Irrtum, der die Ehe zur Fessel macht und manches Leid verursacht. So schützt das menschliche Gesetz die Form, auch wenn sie, ihres Inhaltes längst beraubt, nur Klammer ist für irdische Verpflichtung. Ja, manche halten es für gottgeboten, daß eine Ehe untrennbar verbleibt, anstatt sie auf dem Wege der Entwicklung des Geistes nur als Stufe anzusehen, die, wenn sie keinen Halt mehr bietet und schon der Absturz in die Tiefe droht, zu beider Rettung zu verlassen ist. Denn wenn die Gatten, anstatt sich zu fördern, durch Starrsinn sich an dem Geistesaufstieg hindern, ist die Verbindung wiederum zu lösen, vor welcher Stelle und in welcher Form auch das Gelöbnis einst gegeben wurde. Wenn gar ein haßerfülltes Sich-Zerreiben den Ehesinn ins Gegenteil verkehrt, erspart die Trennung beiden Gattenteilen, in neue Schuld sich geistig zu verstricken. Denn der Gedanke schon, nicht erst die Tat, kehrt, reich befrachtet mit der gleichen Art, einst unbedingt im Ring der Wechselwirkung auf den zurück, der ihn gezeugt, genährt.
Würde die Aufwärtsentwicklung des Geistes endlich zum Maß aller Ordnung gemacht, wäre kein Zweifel, daß auch die Ehe sich diesem Gebot zu fügen hat. So aber fordern die falschen Begriffe häufig zum Widerspruch heraus. Vielen Paaren erscheint die Ehe heute nicht mehr erstrebenswert. Im unformellen Zusammenleben wollen sie lieber die Selbstbestimmung, die vom Gesetze beschränkt wird, bewahren. Für manche freilich wäre es besser, sie blieben der Ehe überhaupt fern. Durch die Enthebung von Pflichten, die allgemein derzeit gefördert wird, stellt man auch in der Beziehung zum Partner leicht nur die eigenen Wünsche voran. Doch nur wer selbst zu geben bereit ist, kann auch wechselwirkend empfangen. Das Wesen der Ehe bleibt allen verschlossen, denen die selbstlose Liebe fehlt.
Die Hausfrau:
Hausfrau zu sein, erscheint vielen Frauen als ein höchst undankbares Geschick. Wenn – so wie jetzt – das menschliche Ansehen von Berufserfolg und -erträgnis bestimmt wird, tut diese Haltung alles dazu, eine Arbeit, die keine »Karriere« eröffnet, ja, sogar unentgeltlich erfolgt, zur Wertlosigkeit herunterzudrücken. Für diese Ansicht erscheint es bezeichnend, daß immer noch die Sozialgesetzgebung hausfraulichem Tun gegenüber versagt, weil es mit ihrer Vorstellung dessen, was Arbeit ist, nicht vereint werden kann.
So wie die Leistung des schaffenden Künstlers sich kaum in Gesetze einordnen läßt, weil sie nicht nur dem Broterwerb dient, sondern Selbstverwirklichung ist, so läßt sich auch das Werden der Hausfrau nur aus dem weiblichen Geiste verstehen.
Hier sind wir nun an dem kritischen Punkt: Viele meinen, es werde den Frauen nur eingeredet, das Heim zu betreuen. Sie können die Irrigkeit dieser Behauptung unschwer in Ihrer Umwelt erkennen. Achten Sie doch auf innen und außen. Blicken Sie in den Kelch einer Blüte: Da ist in der Mitte der (weibliche) Stempel umstanden vom Kranze der Staubgefäße. Das reicht hinab in den Aufbau des Stoffes, denn die Materie besteht aus Atomen, die kleinen Sonnensystemen gleichen. Den Kern umkreisen die Elektronen, anders als dieser elektrisch geladen. Die Kernladung nennt man zwar positiv, negativ jene der Elektronen, doch hätte man früher die Eigenschaften dieser Elektrizitäten erkannt, so wären sicher, wie Einstein meint, ihre Bezeichnungen umgekehrt worden. Setzen wir jene Elektrizität, die in der Eigenschaft negativ ist – und die wir nur fälschlich positiv nennen – treffenderweise dem Weiblichen gleich, so steht auch im Stoffe das Weibliche innen. Das Männliche drängt hingegen nach außen und wird dennoch zugleich gehalten von der (weiblichen) Anziehungskraft, die von der Ladung des Kernes ausgeht.
Ähnliches wiederholt sich in uns. Man hat schon im alten China gewußt, daß unsichtbare, lebendige Ströme auf unverrückbar bestimmten Bahnen – genannt: Meridiane – den Körper durchziehen. Auf ihnen beruht die Akupunktur, die heute kaum mehr bestritten wird. Die Ströme sind zweifach, teils aktiv, teils passiv. Auch hier liegen nun an den Extremitäten die Bahnen der (weiblichen) Ying-Ströme innen, jene der (männlichen) Yang-Ströme außen, und selbst die Pulsdiagnostik ertastet die ersteren tiefer drinnen im Körper, die letzteren näher der Oberfläche.
Sie können die Reihe beliebig verlängern, überall waltet die nämliche Ordnung: Weibliches innen – Männliches außen. So ist es keineswegs Dichterfreiheit oder veraltetes Vorurteil, wenn wir bei Schiller die Verse finden: »Der Mann muß hinaus ins feindliche Leben«, doch: »… drinnenwaltet die züchtige Hausfrau …« Dies ist der natürliche Standort der Frau als Hüterin des inneren Kreises, wobei sogar die kindliche Reinheit, durch die allein das heilige Feuer der Lichtverbindung bewahrt werden kann, von dem Worte »züchtig« erfaßt wird.
Gerade das Innen-stehen-Dürfen sollte der Frau Beglückung bedeuten, liegt doch darin die Bestätigung, daß sie den höheren Werten des Lebens sich leichter zu nähern vermag als der Mann. Die Sprache bringt dies trefflich zum Ausdruck: »Äußerlichkeiten« erscheinen belanglos, »Verinnerlichung« gibt uns erst Wert.
Während der Mann durch den äußeren Schutz dem Weibe jene Geborgenheit bietet, die es im irdischen Dasein benötigt, um lichterem Wirken sich zuzuwenden, obliegt es der Frau, den inneren Frieden durch die Gestaltung des Heimes zu sichern. Wird Harmonie von hier aus verbreitet, wirkt sie veredelnd auf alles ein. Hier soll das irdische Abbild erstehen der wundersamen Geborgenheit, die durch das Leben im Schöpfungsgesetze den Geist nach gereifter Rückkehr erwartet. Unbewußt lebt ja in jedem die Sehnsucht nach dieser Heimat, dem Paradies.
Das Wirken der Hausfrau vollzieht sich im stillen, es wird ihr nur selten Beifall gezollt. Doch hat nicht, was sich so laut gebärdet, es nötig, sich bemerkbar zu machen? Echtes und Wahres drängt sich nie auf.
Und sollte Ihnen das Walten im Heim dennoch zu unbedeutend erscheinen, so möge zur Widerlegung dessen ein zeitnah-praktisches Beispiel dienen: Als im Vorjahr die Rohölverknappung zur Schließung vieler Tankstellen führte, wurden weite Bevölkerungskreise nahezu von einer Panik erfaßt. Und doch ging es nur um Motorentreibstoff, ein Mittel zur Maschinenbewegung! Als Hausfrau sind Sie der »Tankstellenwart« an der Zapfsäule eines besonderen Kraftstoffes, der der Bewegung des Geistes dient. Sie betreiben die »Servicestation«, ohne deren hilfreiche Dienste auch der schneidigste »Herrenfahrer« kaum wohlbehalten ans Ziel gelangte. Mag er sich in seinem »Fahrzeug« dann noch so überlegen gebärden, so steckt doch letztlich die Kraft dahinter, die er von Ihnen mitbekam. ...
DIE MISSVERSTANDENE GLEICHHEIT
Tief verwurzelt ist die Vorstellung, daß alle Menschen von ihrem Ursprunge her eigentlich gleich sein müßten. Die in der Folge unbestreitbar in Erscheinung tretende Verschiedenheit möchte man nur allzu gerne weitestgehend den Umwelteinflüssen zuschreiben, denen der Mensch im Laufe seines Lebens ausgesetzt ist. Jene Forscher, die auf Grund eingehender Untersuchungen vor allem die Vererbung als ausschlaggebend ansehen, wie etwa J. B. S. Haldane, Thomas H. Huxley und Hans-Jürgen Eysenk (»Die Ungleichheit der Menschen«, List-Verlag), wurden vielfach auf das heftigste angegriffen. Denn wenn der Vererbung der maßgebliche Anteil an der menschlichen Unterschiedlichkeit zukommt, dann ist der Mensch Umständen ausgeliefert, die sich seinem Willen entziehen und wie ein frivoles Spiel blindwütigen Schicksals erscheinen müssen. Die darin liegende Zufälligkeit rüttelt zutiefst an unseren Glaubensvorstellungen. Sie muß Zweifel erwecken am Wirken eines gerechten Gottes.
Wieder aber ist es nur der Mensch selbst, der durch sein falsches Denken Unklarheit und Verwirrung schafft. Wohl ist es richtig, daß die Menschen von ihrem Ursprunge her gleich geschaffen sind, das heißt gleiche Anlagen und Möglichkeiten zu ihrer Entwicklung in sich tragen, doch dieser Ursprung liegt für den einzelnen Menschen nicht in seiner jetzigen Erdgeburt. Viele Leben auf dieser Erde sind ihr schon vorausgegangen. In diesen hat er die in ihm ruhenden Anlagen durch seinen Willen und durch Erfahrung schon in bestimmter Weise entfaltet. Mit dieser dadurch bereits gewonnenen Prägung, die in seinen Eigenschaften, Neigungen und Fähigkeiten Ausdruck findet, tritt er in sein jeweils neues Erdenleben. Der Mensch ist zu diesem Zeitpunkt also keineswegs mehr ein »unbeschriebenes Blatt«.
Diese Wiedergeburten – wohlgemerkt: stets als Mensch – sollten eigentlich für niemanden überraschend sein. Mehr als die Hälfte der Erdenmenschheit ist, wenn auch in mitunter etwas abgewandelten Vorstellungen, davon überzeugt. Für den abendländischen Menschen scheint dies allerdings dem fernöstlichen Glaubensgut zu entstammen. Aber dem ist nicht so.
Es sollen hier nicht die zahlreichen Zeugnisse auch westlicher Denker über die Wiedergeburt angeführt werden; darüber gibt es Schrifttum genug. Für unsere vorherrschend dem christlichen Glauben zugewandte westliche Welt muß es vor allem bedeutsam erscheinen, daß das Wissen von der Wiedergeburt einst auch an den Wurzeln dieser Lehre zu finden war.
Gerade die Bibel, die doch die Grundlage des christlichen Glaubens bildet, enthält nicht zu übersehende Hinweise auf das Wissen von der Wiedergeburt. So finden wir schon im Alten Testament im 90. Psalm den Vers:
»Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder!«,
und bei Maleachi (3,23) finden wir die Verheißung der Wiederkunft des Propheten Elias. Elias aber lebte im 9. Jahrhundert vor Christus. Dennoch aber wurde, wie wir aus dem Neuen Testament erfahren, sowohl von Johannes dem Täufer wie auch von Jesus vermutet, daß sie der wiedergeborene Elias seien (Markus 6,15; Matthäus 16,13–14; Lukas 9,18–19; Markus 8,27–28). Man sprach, den genannten Evangelisten zufolge, im Volke von Jesus aber auch als einer Wiederkunft des Propheten Jeremias aus dem 7. vorchristlichen Jahrhundert oder des enthaupteten Johannes des Täufers. Zwar wies Jesus für seine Person diese Vermutungen zurück, keineswegs aber den Gedanken an die Wiedergeburt. Im Gegenteil: Er bestätigte, daß es sich bei Johannes dem Täufer um den wiedergeborenen Elias gehandelt habe! (Matthäus 17,10–12; 11,11–14)
Lassen schon diese Berichte deutlich erkennen, daß Jesus eine Wiedergeburt nicht ausdrücklich lehren mußte, weil sie zu seiner Zeit gar nicht bezweifelt wurde, so wird dieses Bewußtsein durch jene Schilderung besonders deutlich, die der Heilung des Blindgeborenen vorausgeht. Hier heißt es bei Johannes (9,1–2):
»Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er ist blind geboren?«
Wer schon vor seiner Geburt gesündigt haben kann, muß aber schon vorher gelebt haben. Die Frage der Jünger schließt dies – nicht etwa zweifelnd, sondern als mögliche Ursache – ein. Der Evangelist bringt damit zum Ausdruck, daß auch für die Jünger die Wiedergeburt außer Frage stand. Und Jesus hält ihnen nicht etwa die Unsinnigkeit einer solchen Annahme vor, sondern geht auf ihre Frage ein, indem er erklärt, daß »weder dieser gesündigt habe, noch seine Eltern«, sondern daß es sich hier, in diesem besonderen Falle, um ein Werkzeug Gottes handelt (Johannes 9,3). Berücksichtigt man, daß das Evangelium ja erst geraume Zeit nach dem Tode Jesu niedergeschrieben wurde und dennoch diese Begebenheit nicht etwa weggelassen, anders gefaßt oder erläutert worden ist, so ergibt sich, daß jedenfalls auch über die Zeit Jesu hinaus der Wiedergeburtsglaube vorhanden war.
Es muß daher verwundern, daß das christliche Lehrgebäude, das sich doch auf diese biblischen Berichte gründet, das Wissen von der Wiedergeburt nicht mehr enthält, ja, diese sogar verneint.
Aber das war nicht immer der Fall. Noch bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts war der Glaube an die Wiedergeburt auch im Christentum vorhanden. Er wurde vor allem von Origenes (185–254) vertreten, der als »der größte Gelehrte und weitaus fruchtbarste theologische Schriftsteller seiner Zeit, mehr noch, als der bedeutendste der Gesamtkirche vor Augustinus« bezeichnet wird. In seinem Hauptwerk »De principiis« (»Von den Ursprüngen«) gab er die erste systematische Darstellung der christlichen Glaubenslehre, die auch die Wiedergeburt umfaßte. Der ganze christliche Westen war, wie Basil Studer meint, um die Wende des 4. zum 5. nachchristlichen Jahrhundert mit der Lehre des Origenes vertraut.
Wie jede überragende Persönlichkeit rief freilich auch er Neider und Gegner auf den Plan. So wurden seine Lehren lange nach seinem Tode in die zahlreichen Glaubensstreitigkeiten hineingezogen, die damals die christliche Welt erschütterten.
Dazu gehörte unter anderem auch die Frage nach der Natur Jesu. Die sogenannten »Monophysiten« vertraten, vereinfacht ausgedrückt, den Standpunkt, Jesus sei »Gottmensch« in einer Person gewesen. Demgegenüber stand die Auffassung der »Dyophysiten«, die der Ansicht waren, Jesus habe zwei Naturen – Gott und Mensch – in sich vereinigt. Muß man sich allein schon über die Anmaßung wundern, daß Menschen sich für berufen erachteten, darüber zu befinden, so erscheint es für uns Heutige kaum glaublich, daß derartige Meinungsverschiedenheiten geeignet waren, das Gefüge des Römischen Reiches zu gefährden. Tatsächlich aber war es so, denn Staats- und Kirchenpolitik waren in diesen Jahrhunderten auf das engste miteinander verquickt.
Auf die zahllosen Wirren und Intrigen, die damit verbunden waren, sei hier nicht näher eingegangen. Sie sind ein düsteres Kapitel der Religionsgeschichte. Neben dem Streit zwischen Monophysiten und Dyophysiten tobte durch mehr als zwei Jahrhunderte auch ein Kampf über verschiedene andere Lehrmeinungen und Schriften, der als der sogenannte »Drei-Kapitel-Streit« in die Geschichte einging. Zur Zeit Justinians I. (527–565) erlebten diese Auseinandersetzungen einen neuen Höhepunkt. Justinian, der hervorragendste Vertreter weltlicher Kirchenmacht (»Caesaropapismus«), hielt sich, nicht zuletzt zur Erhaltung der Einheit des Reiches, berechtigt und verpflichtet, religiöse Belange bis ins kleinste selbst zu regeln und die Kirche den staatlichen Zwecken dienstbar zu machen. Nun war die politische Lage damals recht kritisch. Mehrere monophysitisch eingestellte Provinzen hatten sich gegen die Zentralmacht aufgelehnt; in Italien waren die Ostgoten eingefallen. Entschiedenes Handeln tat not. Um den Glaubensstreitigkeiten ein Ende zu bereiten und die widerstreitenden Kräfte zu befrieden, berief Justinian im Jahre 553 eine ökumenische Synode – die fünfte ihrer Art – nach Konstantinopel ein. Um einem Verlangen der Dyophysiten zu entsprechen, trug er dieser Kirchenversammlung auf, einerseits die Lehren des Origenes zu verdammen, andererseits aber im erwähnten »Drei-Kapitel-Streit« eine Entscheidung zu treffen, die den Monophysiten genehm war, die ihrerseits den Lehren des Origenes anhingen. Beiden Teilen brachten die Beschlüsse also teilweise Zugeständnisse. Um diese Ausgewogenheit zu erreichen, schrieb der Kaiser selbst jene Punkte (Anathemata) vor, mit welchen die Verdammung der jeweiligen Lehrmeinungen auszusprechen war. Der Papst Vigilius I., der sich zunächst geweigert hatte, diese Beschlüsse zu bestätigen, durfte Konstantinopel erst verlassen, nachdem er sich hierzu bereit gefunden hatte. Damit erlangten die Ergebnisse jenes 2. Konzils von Konstantinopel für die Gesamtkirche Verbindlichkeit.
Es muß im Hinblick auf diese Tatsachen also festgehalten werden: Weder eine neue Offenbarung noch eine bessere Einsicht haben dazu geführt, daß der Glaube an die Wiedergeburt aus dem christlichen Bekenntnis ausgeschieden wurde. Vielmehr wurde mit dem Gesamtwerk des Origenes auch diese Lehre einer rein politischen Zweckmäßigkeit geopfert. Durch die vom Kaiser erzwungene Entscheidung aber wurde die abendländische Christenheit des Schlüssels zum Verständnis der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes und ihres Daseinszusammenhanges beraubt. Seither schleppt sie dieses Erbe des Justinian und seiner Zeit als einengende Fessel mit.
Denn die Bedeutung dieses Ereignisses geht noch weiter. Auch die hier zu behandelnde Frage nach der Ursache der unbestreitbaren Ungleichheit der Menschen und der vermeintlich darin gelegenen Ungerechtigkeit des Schöpfers hatte nämlich in den Schriften des Origenes bereits eine Antwort gefunden:
»Da er [Gott] selbst der Grund war für das zu Schaffende und in ihm keine Verschiedenheit, keine Veränderlichkeit und kein Unvermögen war, schuf er alle Wesen, die er schuf, gleich und ähnlich, da es für ihn keinen Grund für Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit gab. Aber da die Vernunftgeschöpfe selbst […] mit der Fähigkeit der freien Entscheidung beschenkt sind, regte die Willensfreiheit einen jeden entweder zum Fortschritt durch Nachahmung Gottes an oder zog ihn zum Abfall durch Nachlässigkeit. Dies wurde für die Vernunftwesen […] zur Ursache der Verschiedenheit; sie hat ihren Ursprung also nicht im Willen und der Entscheidung des Schöpfers, sondern im eigenen freien Entschluß […] Auf diese Weise wird der Schöpfer nicht ungerecht erscheinen, wenn er infolge vorausgehender Ursachen jedem nach Verdienst seine Stelle gibt; und man wird auch nicht glauben, Glück oder Unglück der Geburt und das besondere Geschick, das mit ihr gegeben ist, beruhten auf Zufall.« (De principiis II 9, 5–6)
Mag auf Grund des uns durch die Gralsbotschaft geschenkten Wissens hier manches noch zu ergänzen oder zurechtzurücken sein, so bleibt doch das Entscheidende: die Einsicht, daß die Verschiedenheit der Menschen sich als Folge ihrer in vorausgängigen Daseinswanderungen getroffenen Willensentscheidungen ergibt. Heute noch sucht die Menschheit nach diesem achtlos weggeworfenen Wissensschatz. Die Forscher geraten in erbitterten Streit über die Bedeutung aufwendig erhobener Tatsachen, die sie zwar feststellen, aber nicht erklären können. Denn eine Wissenschaft, die das Geistige nicht einbezieht und es vom Stofflichen nicht zu trennen weiß, muß zu schiefen Ergebnissen gelangen und in Sackgassen münden.
Diese sind, wie stets, die äußersten Gegensätzlichkeiten:
»Heutzutage proklamieren die extremen Eugeniker, daß die Umwelt einen sehr geringen Einfluß hat, extreme Behavioristen hingegen, daß nichts außer ihr eine Rolle spielt«,
so kennzeichnete J. B. S. Haldane schon vor einem halben Jahrhundert die Lage (»The Inequality of Man«, Chatto & Windus).
Inzwischen hat sich freilich manches geändert. Selbst die verbissensten Verfechter der Milieutheorie können nicht länger behaupten, daß allein die Umweltbedingungen für die Unterschiedlichkeit der Menschen verantwortlich wären. Zu deutlich hat vor allem die Zwillingsforschung – insbesondere bei eineiigen Zwillingen, die getrennt unter gänzlich verschiedenen Bedingungen aufwuchsen – eine solche Auffassung widerlegt. Die bis ins einzelne reichende Gleichartigkeit auch solcher Personen in ihrem Gehaben, ihren Eigenheiten und Interessen verwies eindeutig auf eine Gemeinschaft der Anlagen schon von Geburt her. Wenn Eysenck demnach heute nur 20 Prozent der Verschiedenheit den Umwelteinflüssen zuordnet, 80 Prozent aber der Vererbung, dann ist er auf dem rechten Wege – und irrt dennoch.
Die Wissenschaft – und mit ihr der allgemeine Sprachgebrauch – bezieht nämlich den Begriff der Vererbung auf zwei völlig getrennte Erscheinungsformen: auf die körperliche Beschaffenheit, die dem Stofflichen zugeordnet ist, aber auch auf Eigenschaften, Neigungen und Fähigkeiten, die – zur Persönlichkeit des Menschen gehörig – Auswirkungen seines Geistes sind. Dieser Geist aber ist auf dem Wege vom Ausgangspunkt, an dem er noch allen anderen gleich war, durch vielerlei Leben zu jenem unverwechselbaren Ich geworden, das eben jene Verhaltensweisen – guter oder unguter Art – aus dem »Pfunde, mit dem es wuchern sollte« entwickelt und hervorgebracht hat. Dieses »Ich« bedarf nicht des »Erbguts« von seiten der Eltern, um seine Eigenart zu entfalten, es bringt sie schon mit.
Was der Mensch jedoch benötigt, ist jene Grundlage, die es ihm ermöglicht, dieser Beschaffenheit seines Geistes entsprechend dessen Entwicklung fortzusetzen. Die unverrückbaren Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung sorgen dafür, indem sie den Geist bei seiner neuerlichen Erdgeburt in jene Verhältnisse führen, welche diese Voraussetzungen für ihn erfüllen. Ohne hier im einzelnen auf die sich dabei auswirkenden Einflüsse einzugehen, sei – um die von der Wissenschaft umstrittene Frage vom Grundlegenden her zur Klärung zu bringen – aus der Gralsbotschaft zitiert:
»Der Volksmund sagt gar nicht mit Unrecht oft von dieser oder jener Eigenschaft des Menschen: ›Es liegt ihm im Blute!‹ Damit soll in den meisten Fällen das ›Ererbte‹ ausgedrückt werden. Oft ist es auch so, da grobstoffliche Vererbungen stattfinden, während geistige Vererbungen unmöglich sind. Im Geistigen kommt das Gesetz der Anziehung der Gleichart in Betracht, dessen Wirkung äußerlich im Erdenleben das Aussehen einer Vererbung trägt und deshalb leicht damit verwechselt werden kann.« (Vortrag »Das Temperament«)
| ISBN | 978-3-87860-525-6 |
|---|---|
| Autor | Richard Steinpach |
| Format | .epub, .mobi (ohne Kopierschutz/DRM) |
| Język | Deutsch |
| Czas dostawy | Sofort nach Zahlung verfügbar |